Alfred Kerr - ein deutsches Drama
von Michael Jetter
Wenn
man sich mit dem legendären deutschen Theaterkritiker Alfred Kerr beschäftigt,
dann begegnet man einem Mann, der meinungsstark und kämpferisch für seine
Überzeugungen im Bezug auf das Theater eingetreten ist, aber eben nicht nur für
das Theater, sondern letztendlich für die Freiheit des Menschen, den freien und
selbstbestimmten Bürger.
Alfred Kerr 1867 in Breslau geboren, war spätestens seit Mitte der neunziger
Jahre des vorletzten Jahrhunderts die Stimme im deutschen Reich, die
Theaterkarrieren befördern konnte, aber auch Karrieren zumindest zu behindern
vermochte. Das diesseits und jenseits der Theaterbühnen theatrale Berlin war
das Epizentrum der deutschen Dramaturgie, und eben aus dieser Stadt sendete
Kerr seine Idee eines den Menschen ins Zentrum rückenden dramaturgischen
Vorgangs, der mit den Mitteln des Theaters, seinen Beitrag zur
Demokratieentwicklung leisten sollte.
Leseempfehlung: Alfred Kerr / Die Biographie / von Deborah Vietor-Engländer
/ 718 Seiten
Die unzähligen deutschen Bühnen wurden immer wieder von der kaiserlichen
Zensur bedroht, oder eben konkret behindert, und gegen diesen Vorgang lehnte
sich Alfred Kerr immer wieder u.a. in seiner im Berliner Tageblatt publizierten
Kolumne "Briefe aus Berlin" auf, immer am Rande der Legalität, aber
sprachlich und rhetorisch so gewandt, dass ihm im Gegensatz zu vielen
Mitstreitern ein Gefängnisaufenthalt erspart blieb. Ein wahrer Verteidiger des
gesprochenen und vor allen Dingen geschriebenen Wortes.
Kerr verstand die Theaterkritik als eine Kunstform, die sich nicht auf das
Nacherzählen von Handlungen reduzierten sollte, sondern in ihrer Beschreibung
und Aufbau ein eigenes Kunstwerk darzustellen hatte. Die Auseinandersetzung mit
dem Stoff ging weit über das Dargebotene hinaus, sollte sie in das
Zeitgeschehen einbetten, sollte aber auch sprachlich den höchsten Ansprüchen
genügen, und eine historische Einordnung leisten.
Nach der Lektüre von so mancher aktuell publizierten Theaterkritik, kann man
nur ohnmächtig zur Schlussfolgerung gelangen, dass manche Redaktion am Vortag in
die Redaktionskonferenz hineinfragt, "Wer hat denn morgen Abend Lust auf
ein bisserl Theater". Das ist im übrigen wie beim Thema Wein, sehr oft
befremdet es mich, was man so in renommierten Zeitungen für schlecht
recherchierte Artikel zu lesen bekommt, aber das ist natürlich ein anderes
Thema, und soll an dieser Stelle keine Fortsetzung finden. Nur noch ganz
nebenbei erwähnt, Kerr war der Sohn eines Breslauer Weinhändlers.
Die großen Menschen und Realitätsbeschreiber Hendrik Ibsen und Gerhart Hauptmann, um nur zwei Welttheaterautoren zu nennen, wurden von Kerr in Ihrer
Substanz und Erzählkraft sehr früh identifiziert, und über Jahrzehnte im
öffentlichen feuilletonistischen Diskurs gefördert, um aber auch dann Kritik an
ihnen zu üben, wenn es ihm angemessen erschien.
Kerr dachte im großen Stil, für ihn waren Theaterstücke nur dann wirklich
interessant, wenn ein Autor in der Lage war, letztendlich ein zeitloses Stück
zu konstruieren, dass losgelöst von aktuellen stofflichen Bezügen auch noch in
zweihundert Jahren vor Relevanz strotzt, und insofern als Kunstwerk zu
bezeichnen ist.
Heute wissen wir, dass er mit dem Norweger Ibsen und dem deutschen Hauptmann
den totalen Instinkt offenbarte. Ich habe mittlerweile sehr viele Ibsen
Inszenierungen gesehen, zuletzt in Bochum "Ein Volksverräter" in der
Regie von Hermann Schmidt-Rahmer, und es ist wirklich berührend, welchen
Seeleneinblick seine Figuren offerieren, und wie seine damalige Gesellschaftskritik,
das Werk wurde 1882 veröffentlicht, sich in das Heute übertragen lässt.
Im Schauspielhaus Bochum heißt "Ein Volksfeind" nicht ohne Grund
"Ein Volksverräter" und thematisiert den aktuellen Rechtspopulismus
anhand des Badearztes Tomas Stockmann, der sich in dieser Inszenierung rechter
Kommunikationsstrategien bedient, um den Kampf um reines Wasser im städtischen
Bad für sich zu entscheiden. Es ist also kein plakativer und selbstreferentieller
Anti AFD Abend, sondern eine intelligente Offenlegung vom sprachlichen und
agitatorischen Handeln der rechtspopulistischen Protagonisten. Ibsen bietet auch
136 Jahre später den Rahmen hierfür.
Alfred Kerr, der während des Kaiserreichs und der anschließenden Weimarer Republik eine wichtige und einflussreiche demokratische Stimme im öffentlichen Diskurs war, warnte immer wieder vor dem aufkommenden Nationalsozialismus, und konnte ihn wie sein Mitstreiter Kurt Tucholsky doch nicht verhindern. Fluchtartig musste er im Februar 1933 sein geliebtes Deutschland verlassen, und verlor auf diese Weise Arbeit und Heimat. Mit der Bücherverbrennung wurde sein Werk für 12 Jahre unzugänglich gemacht, aber die Macht seiner Sprache, seine Haltung und seine Liebe zum Theater sind unzerstörbar.
Unfassbar gekränkt und verletzt musste er nach seiner überstürzten
Emigration zur Kenntnis nehmen, wie sein geliebter Theaterautor, den er bei
jeder Gelegenheit dem internationalen Theaterpublikum anempfahl, ihn ob seiner
den Menschen in das Zentrum rückenden Inszenierungen (z.B. Die Ratten, z.B. Die
Weber) rücksichtslos protegierte, Gerhart Hauptmann, einen hässlichen Pakt mit
den Nazis einging, und sich dieser Gerhart Hauptmann auf das schändlichste von
seinem feuilletonistischen Förderer distanzierte.
Wie bitter muss es für jüdischen Deutschen Alfred Kerr gewesen sein, diesen
Verrat zu verkraften, ohne als Deutscher auf deutschen Boden dieser
Menschenverachtung als Autor und Mensch begegnen zu können. Der 1938 von
Hauptmann in seinem Tagebuch getätigte Eintrag bringt seine Haltung zu den
jüdischen Kollegen exemplarisch zum Ausdruck: "Ich muss endlich diese
sentimentale Judenfrage für mich ganz abtun. Es stehen wichtigere, höhere
deutsche Dinge auf dem Spiel."
Diese unendliche Traurigkeit über den Verlust der Heimat findet am
deutlichsten in diesem Gedicht Ausdruck, das Alfred Kerr anläßlich seines 75.
Geburtstags 1942 im Londoner Exil mit stockender Stimme vortrug. Ein
Weinliebhaber war dieser Mann ganz offensichtlich auch.
Grüne Zeiten im lieblichen Licht
Wenn ich noch einmal nach Deutschland ginge...
(Ich tu`s aber nicht!) -
Dann tränk` ich im schwärmenden Überschwang
Deutschen Wein einen Sommertag lang!
Ich wählte für dieses Tageswerk
Nicht Assmannshauser Roten,
Ich tränke Dürkheimer Feuerberg
Heut kneipen ihn knechtische Knoten,
Ich tränk ihn zu Dürkheim, ich tränk ihn zu Bonn,
Ich trink ihn nimmer - doch träume ich davon."
Hauptmann wird auch heute noch völlig zu Recht auf deutschen Bühnen rauf und
runter gespielt, aber in der Gesamtbetrachtung, bzw. als Mensch hat er sich
genau im entscheidenden Moment für das Menschenverachtende und gegen das
Menschenfreundliche entschieden, bizarrerweise in völliger Umkehrung zu seinen
sozialkritischen und arbeiterfreundlichen Theaterstücken, die von Alfred Kerr
regelrecht geliebt und verehrt wurden. Ein deutsches Paradox, eine Bürde, die
wir heute noch zu tragen haben.
Lesen Sie Alfred Kerr, er lehrt uns viel mehr über das Heute, als der aktuelle und in großen Teilen fahrige Digitaljournalismus dem geneigten Leser bieten kann.
Ihr
Michael Jetter
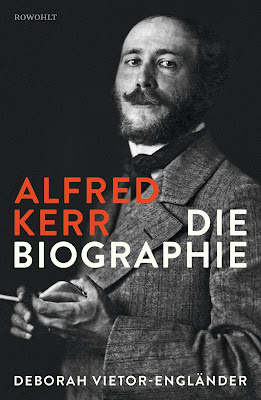

Kommentare
Kommentar veröffentlichen